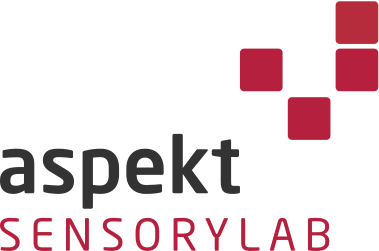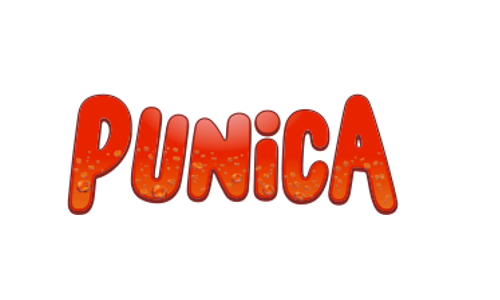Visualisieren & Realisieren
Wir planen und realisieren Sensoriklabore seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Food, Non-Food, Qualität, Marktforschung, Marketing, Forschung und Innovation. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir den genauen Bedarf für Ihre Situation.
Bereits in der Angebotsphase erhalten Sie kostenfrei und unverbindlich eine 3D-Visualisierung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
aspekt schreinerarbeiten e. K. ist Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Sensorik DGSens
Fixed-Sensory-Table-Electric (FST-E)
Elektrischer Sensoriktisch ohne Kompromisse
für Gruppenarbeit, Diskussion, Schulung und sensorische Analysen in einem Raum ab 12 m²
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Fixed-Sensory-Table-Foldable (FST-F)
Manueller Sensoriktisch für Gruppenarbeit, Diskussion, Schulung
und sensorische Analysen in einem Raum ab 12 m²
zum Lösungsansatz
Fixed-Sensory-Table (FST-E)
Sensoriktisch für Gruppenarbeit, Diskussion, Schulung und sensorische Analysen in einem Raum ab 20 m²
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Fixed-Sensory-Booth (FSB)
Prüfkabinen in Endlosbauweise, frei im Raum stehend
oder in Wandausschnitte platziert
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Fixed-Sensory-Booth (FSB)
Prüfkabinen in Endlosbauweise, frei im Raum stehend oder in Wandausschnitte platziert
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Fixed-Sensory-Lab (FSL)
Prüfkabinen in Endlosbauweise, frei im Raum stehend
oder in Wandausschnitte platziert
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Fixed-Sensory-Lab (FSL)
Prüfkabinen in Endlosbauweise, frei im Raum stehend oder in Wandausschnitte platziert
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Mobile-Sensory-Booth (MSB)
mobile Prüfkabine, mit Durchreichenvarianten
fahrbar durch Zimmertüren und in Aufzüge
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
Mobile-Sensory-Booth (MSB)
mobile Prüfkabine, mit Durchreichenvarianten fahrbar durch Zimmertüren und in Aufzüge
zum Lösungsansatz mit Projektbeispielen
DIN EN ISO 8589 (Sensorische Analyse – Allgemeiner Leitfaden für die Gestaltung von Prüfräumen) – die Grundlage für alle Lösungsansätze
Alle Prüfbereiche sind mit Testplatz-Beleuchtungen erhältlich. Es kann zwischen Warm- und Kaltweiß (mit sehr hohem Farbwiedergabeindex), sowie Rot-, Grün- oder Blaulicht (RGB) gewechselt, gemischt, gedimmt und gespeichert werden. Die Beleuchtungsszenen werden durch programmierte Taster oder per App aufgerufen.
Lösungen für angrenzende Unternehmensbereiche
Sensoriklabor mit Prüf- und Vorbereitungsbereichen, an Boden, Wand und Decke angearbeitet
Lösungen für angrenzende Unternehmensbereiche
Sensoriklabor mit Prüf- und Vorbereitungsbereichen, an Boden, Wand und Decke angearbeitet